Das Erbgut der Menschen befindet sich in jedem Zellkern und ist in Chromosomen verpackt. Die Chromosomen bestehen aus kompakten DNA-Molekülen und werden durch Histone zusammengehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Chromosomen
- Definition - Was sind Chromosomen?
- Wie sind Chromosomen aufgebaut?
- Was sind die Telomere?
- Was ist Chromatin?
- Haploide Chromosomen
- Polytäne Chromosomen
- Welche Funktionen haben die Chromosomen?
- Wie werden die Erbanlagen über die Chromosomen weitergegeben?
- Was ist der normale Chromosomensatz beim Menschen?
- Warum gibt es immer Chromosomenpaare?
- Was ist eine Chromosomenmutation?
- Was ist eine Chromosomenaberration?
- Trisomie 21
- Trisomie 13
- Trisomie 16
- Trisomie 18
- Trisomie X
- Fragiles-X-Syndrom
- Was ist eine Chromosomenanalyse?
- Empfehlungen aus der Redaktion
Chromosomen
Definition - Was sind Chromosomen?
Die Erbanlagen einer Zelle werden in Form der DNA (Desoxyribonukleinsäure) und ihrer Basen (Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin) gespeichert. Bei allen eukaryontischen Zellen (Tiere, Pflanzen, Pilze) liegt diese im Zellkern in Form von Chromosomen vor. Ein Chromosom besteht dabei aus einem einzigen zusammenhängenden DNA-Molekül, welches mit bestimmten Proteinen (Eiweißen) verbunden ist.
Der Name Chromosom leitet sich aus dem Griechischen ab und ließe sich in etwa als „Farbkörper“ übersetzen. Dieser Name kommt daher, dass es Wissenschaftlern schon recht früh in der Geschichte der Zytologie (1888) gelungen ist diese mittels spezieller basischer Farbstoffe anzufärben und im Lichtmikroskop zu identifizieren. Wirklich gut sichtbar sind sie allerdings nur zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zellzyklus, der Mitose (bei Keimzellen Meiose), wenn das Chromosom in besonders dichter (kondensierter) Form vorliegt.
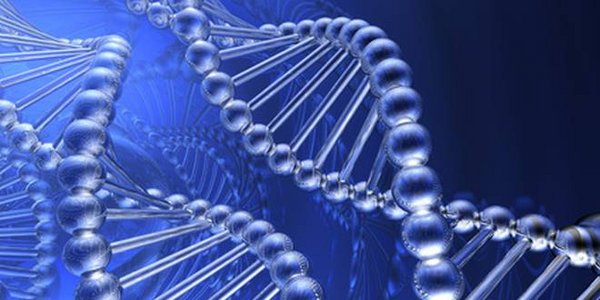
Wie sind Chromosomen aufgebaut?
Würde man die gesamte DNA-Doppelhelix einer Zelle, also rund 3,4 x 109 Basenpaare, aneinanderhängen, ergäbe sich daraus eine Länge von über einem Meter. Die Gesamtlänge aller Chromosomen addiert beträgt aber nur etwa 115 µm. Diese Längendifferenz erklärt sich durch den sehr kompakten Aufbau der Chromosomen, bei dem die DNA gleich mehrfach auf sehr spezifische Weise gewunden bzw. spiralisiert wird.
Dabei spielen Histone, eine spezielle Form von Proteinen (Eiweißen), eine wichtige Rolle. Insgesamt gibt es 5 verschieden Histone: H1, H2A, H2B, H3 und H4. Jeweils zwei der letzten vier Histone lagern sich zu einem zylindrischen Gebilde, dem Oktamer, zusammen, um welches sich die Doppelhelix etwa zweimal windet (= Superhelix). H1 lagert sich an dieses Gebilde an, um es zu stabilisieren.
Dieser Komplex aus DNA, Oktamer und H1 wird als Nukleosom bezeichnet. Mehrere dieser Nukleosomen liegen nun „perlenkettenartig“ in relativ kurzen Abständen (10-60 Basenpaare) hintereinander. Die Abschnitte zwischen den Chromosomen werden als Spacer-DNA bezeichnet. Die einzelnen Nukleosomen treten nun wiederum über H1 in Kontakt, wodurch eine weitere Spiralisierung und damit auch eine Verdichtung entsteht.
Der entstandene Strang wiederum liegt in Schleifen vor, die durch ein Rückgrat aus sauren Nicht-Histon-Proteinen, auch als Hertone bezeichnet, stabilisiert werden. Diese Schleifen liegen wiederum in durch Proteine stabilisierten Spiralen vor, woraus sich die letzte Stufe der Verdichtung ergibt. Dieser hohe Verdichtungsgrad kommt allerdings nur im Rahmen der Zellteilung bei der Mitose vor.
In dieser Phase erkennt man auch die charakteristische Gestalt der Chromosomen, welche sich aus zwei Chromatiden zusammensetzt. Die Stelle an der diese zusammenhängen wird Zentromer genannt. Es unterteilt jedes Metaphase-Chromosom in zwei kurze und zwei lange Arme, die man auch p- und q-Arme nennt.
Liegt das Zentromer etwa in der Mitte des Chromosoms, spricht man von einem metazentrischen, liegt es ganz an einem der Enden von einem akrozentrischen Chromosom. Die dazwischen liegenden werden submetazentrische Chromosomen genannt. Diese schon unter dem Lichtmikroskop erkennbaren Unterschiede ermöglichen gemeinsam mit der Länge eine erste Einteilung der Chromosomen.
Was sind die Telomere?
Als Telomere bezeichnet man die Enden der Chromosomen, an denen sich wiederholende Sequenzen (TTAGGG) befinden. Diese tragen keine relevanten Informationen, sondern dienen Einzug dazu den Verlust von relevanteren DNA-Abschnitten zu verhindern. Bei jeder Zellteilung geht ein Teil des Chromosoms durch den Mechanismus der DNA-Replikation verloren.
Die Telomere sind also in gewisser Weise ein Puffer, die den Zeitpunkt verzögern, an dem die Zelle durch die Teilung wichtige Informationen verliert. Unterschreiten die Telomere einer Zelle eine Länge von etwa 4.000 Basenpaaren wird der programmierte Zelltod (Apoptose) eingeleitet. Das verhindert die Verbreitung fehlerhaften Erbguts im Organismus. Einige wenige Zellen besitzen Telomerasen, also Enzyme, die in der Lage sind die Telomere wieder zu verlängern.
Neben den Stammzellen, aus denen alle anderen Zellen hervorgehen, handelt es sich dabei um Keimzellen und bestimmte Zellen des Immunsystems. Außerdem finden sich Telomerasen auch in Krebszellen, weswegen man in diesem Zusammenhang auch von Immortalisierung, also „Unsterblichwerdung“, einer Zelle spricht.
Lesen Sie hier alles rund um das Thema: Telomere - Anatomie, Funktion & Erkrankungen
Was ist Chromatin?
Als Chromatin wird der gesamte Inhalt eines Zellkerns bezeichnet, der sich basisch anfärben lässt. Daher umfasst der Begriff neben der DNA auch bestimmte Proteine, z.B. Histone und Hertone (siehe Aufbau), sowie bestimmte RNA-Fragmente (hn- und snRNA).
Je nach Phase im Zellzyklus bzw. je nach genetischer Aktivität liegt dieses Material in unterschiedlicher Dichte vor. Die dichtere Form wird Heterochromatin genannt. Man könnte sie also zum einfacheren Verständnis als „Speicherform“ betrachten und unterscheidet hier wiederum zwischen konstitutivem und fakultativem Heterochromatin.
Konstitutives Heterochromatin ist die dichteste Form, welche in allen Phasen des Zellzyklus in ihrer höchsten Kondensationsstufe vorliegt. Es macht etwa 6,5% des menschlichen Genoms aus und ist hauptsächlich in der Nähe der Zentromere und der Enden der Chromosomenarme (Telomere) zu geringen Anteilen aber auch an anderen Stellen (hauptsächlich Chromosom 1,9,16,19 und Y) lokalisiert. Außerdem befindet sich der Großteil des konstitutiven Heterochromatins in der Nähe der Kernmembran, also an den Rändern des Zellkerns. So ist der Platz in der Mitte für das aktive Chromatin, das Euchromatin, reserviert.
Fakultatives Heterochromatin ist etwas weniger dicht und kann bei Bedarf bzw. je nach Entwicklungsstadium aktiviert und deaktiviert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das zweite X-Chromosom bei weiblichen Karyotypen. Da im Grunde genommen ein X-Chromosom für das Überleben der Zelle genügt, wie es schließlich auch beim Mann ausreicht, wird jeweils eins von beiden schon in der Embryonalphase deaktiviert. das deaktivierte X-Chromosom bezeichnet man als Barr-Körperchen.
Nur während der Zellteilung, im Rahmen der Mitose, kondensiert es vollständig, wobei es in der Metaphase seine höchste Verdichtung erreicht. Da die verschiedenen Gene jedoch unterschiedlich oft abgelesen werden - schließlich wird nicht jedes Protein zu jedem Zeitpunkt in derselben Menge benötigt - unterscheidet man auch hier zwischen aktivem und nicht-aktivem Euchromatin.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema unter: Chromatin
Haploide Chromosomen
Haploid (gr. haploos = einzeln) bedeutet, dass alle Chromosomen einer Zelle einzeln, also nicht wie gewöhnlich in Paaren (diploid), vorliegen. Dies ist der natürliche Zustand aller Ei- und Spermienzellen, bei denen im Rahmen der ersten Reifeteilung der Meiose vorerst nicht die beiden identischen Chromatiden getrennt werden, sondern zuerst alle Chromosomenpaare vereinzelt werden.
Dadurch besitzen die Tochterzellen nach der ersten Reifeteilung beim Menschen nur noch 23 statt der gewöhnlichen 46 Chromosomen, was dem halben, also dem haploiden, Chromosomensatz entspricht. Da diese Tochterzellen aber immer noch eine identische Kopie jedes Chromosoms bestehend aus 2 Chromosomen besitzen, bedarf es der zweiten Reifeteilung, bei der die beiden Chromatiden voneinander getrennt werden.
Polytäne Chromosomen
Bei einem polytänen Chromosom handelt es sich um ein Chromosom aus sehr vielen genetisch identischen Chromatiden. Da solche Chromosomen schon unter geringerer Vergrößerung gut zu erkennen sind, spricht man gelegentlich auch von Riesenchromosomen. Voraussetzung hierfür ist die Endoreplikation, bei der die Chromosomen innerhalb des Zellkerns mehrfach multipliziert werden ohne, dass es zu einer Zellteilung kommt.
Welche Funktionen haben die Chromosomen?
Das Chromosom als Organisationseinheit unseres Erbguts dient in erster Linie dazu bei der Zellteilung eine gleichmäßige Aufteilung des verdoppelten Erbguts auf die Tochterzellen zu gewährleisten. Hierzu lohnt es sich die Mechanismen der Zellteilung bzw. den Zellzyklus genauer unter die Lupe zu nehmen:
Den Großteil des Zellzyklus verbringt die Zelle in der Interphase, womit der gesamte Zeitabschnitt gemeint ist, in dem die Zelle nicht unmittelbar im Begriff ist sich zu teilen. Diese unterteilt sich wiederum in G1-, S- und G2-Phase.
Die G1-Phase (G wie gap, also Lücke) schließt sich unmittelbar an die Zellteilung an. Hier legt die Zelle wieder an Größe zu und führt allgemeine Stoffwechselfunktionen aus.
Von hier aus kann sie auch in die G0-Phase wechseln. Das bedeutet, dass sie in ein nichtmehr teilungsfähiges Stadium wechselt und sich im Normalfall auch stark verändert, um eine ganz spezifische Funktion zu erfüllen (Zelldifferenzierung). Um diese Aufgaben zu erfüllen, werden ganz bestimmte Gene verstärkt abgelesen, andere wiederum weniger oder gar nicht.
Wird ein DNA-Abschnitt lange Zeit nicht benötigt, liegt er häufig in den Teilen der Chromosomen, die über längere Zeit dicht gepackt vorliegen (siehe Chromatin). Dies hat einerseits den Sinn Platz zu sparen, ist aber neben den anderen Mechanismen der Genregulation auch ein zusätzlicher Schutz davor versehentlich doch abgelesen zu werden. Es ist allerdings auch beobachtet worden, dass unter ganz bestimmten Bedingungen differenzierte Zellen aus der G0-Phase wieder in den Zyklus eintreten können.
An die G1-Phase schließt sich die S-Phase an, also die Phase in der neue DNA synthetisiert wird (DNA-Replikation). Hier muss die gesamte DNA in ihrer lockersten Form vorliegen, also alle Chromosomen sind vollständig entspiralisiert (siehe Aufbau).
Am Ende der Synthesephase liegt das gesamte Erbgut doppelt in der Zelle vor. Da die Kopie aber immer noch über das Zentromer (siehe Aufbau) an dem ursprünglichen Chromosom hängt, spricht man nicht von einer Verdopplung der Chromosomen.
Jedes Chromosom besteht nun statt aus einem aus zwei Chromatiden, sodass es später in der Mitose die charakteristische X-Form annehmen kann (X-Form gilt streng genommen nur für metazentrische Chromosomen). In der anschließenden G2-Phase findet die unmittelbare Vorbereitung auf die Zellteilung statt. Dies beinhaltet auch eine ausführliche Kontrolle auf Replikationsfehler und Strangbrüche, welche gegebenenfalls repariert werden können.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten der Zellteilung: die Mitose und die Meiose. Alle Zellen eines Organismus mit Ausnahme der Keimzellen entstehen durch Mitose, deren Aufgabe einzig die Bildung zweier genetisch identischer Tochterzellen ist.
Die Meiose dagegen hat gerade den Sinn genetisch unterschiedliche Zellen zu erzeugen:
In einem ersten Schritt werden dabei die einander entsprechenden (homologen), aber nicht identischen Chromosomen aufgeteilt. Erst im nächsten Schritt werden die aus zwei identischen Chromatiden bestehenden Chromosomen getrennt und auf wieder jeweils zwei Tochterzellen verteilt, sodass im Endeffekt aus einer Vorläuferzelle vier Keimzellen mit jeweils unterschiedlichem Erbgut entstehen.
Für beide Mechanismen sind Form und Aufbau der Chromosomen essentiell: An den hochkondensierten Chromosomen setzen spezielle „Proteinfäden“, der so genannte Spindelapparat, an und ziehen die Chromosomen in einem fein regulierten Prozess von der Mittelebene (Äquatorialebene) an die entgegengesetzten Pole der Zelle um eine gleichmäßige Aufteilung zu gewährleisten. Schon kleine Änderungen in der Mikrostruktur der Chromosomen können hier schwerwiegende Folgen haben.
Bei allen Säugetieren bestimmt das Verhältnis der Geschlechtschromosomen X und Y außerdem das Geschlecht der Nachkommen. Im Grunde genommen kommt es allein darauf an, ob das Spermium, welches sich mit der Eizelle vereinigt ein X- oder ein Y-Chromosom trägt. Da beide Formen von Spermien immer im exakt gleichen Ausmaß gebildet werden, ist die Wahrscheinlichkeit immer für beide Geschlechter immer ausgeglichen. Dieses Zufallssystem garantiert also eine gleichmäßigere Geschlechterverteilung, als dies zum Beispiel über Umweltfaktoren wie die Temperatur der Fall wäre.
Informieren Sie sich auch zum Thema: Zellkernteilung
Wie werden die Erbanlagen über die Chromosomen weitergegeben?
Heute weiß man, dass die Vererbung von Eigenschaften über Gene geschieht, welche in Form von DNA innerhalb der Zellen gespeichert sind. Diese sind wiederum in 46 Chromosomen unterteilt, auf die sich die 25000-30000 menschlichen Gene verteilen.
Neben der Eigenschaft an sich, welche man als Phänotyp bezeichnet, gibt es also noch die genetische Entsprechung, die man Genotyp nennt. Der Ort, an dem sich ein Gen auf einem Chromosom befindet, wird Locus genannt. Da der Mensch jedes Chromosom doppelt besitzt, kommt auch jedes Gen doppelt vor. Einzige Ausnahme hiervon sind die X-chromosomalen Gene bei Männern, da das Y-Chromosom nur einen Bruchteil der Erbinformation trägt, welche man auf dem X-Chromosom findet.
Unterschiedliche Gene, die sich auf demselben Locus befinden, werden als Allele bezeichnet. Häufig gibt es mehr als zwei verschiedene Allele an einem Locus. Man spricht dann von Polymorphismus. Bei einem solchen Allel kann es sich einfach nur um eine harmlose Variante (Normvariante), aber auch um pathologische Mutationen, welche Auslöser für eine Erbkrankheit sein können, handeln.
Reicht dabei die Mutation eines einzigen Gens aus, um den Phänotyp zu verändern, spricht man von monogenen oder Mendel-Erbgängen. Viele der vererbbaren Eigenschaften werden allerdings über mehrere miteinander interagierende Gene vererbt und lassen sich daher viel schwieriger untersuchen.
Da bei einem Mendel-Erbgang Mutter und Vater jeweils eines ihrer beiden Gene an das Kind abgeben, ergeben sich immer vier Kombinationsmöglichkeiten in der nächsten Generation, wobei diese bezogen auf eine Eigenschaft auch gleich sein können. Haben beide Allele eines Individuums dieselbe Auswirkung auf den Phänotyp, ist das Individuum bezogen auf dieses Merkmal homozygot und das Merkmal wird entsprechend vollumfänglich ausprägt.
Heterozygote besitzen zwei verschiedene Allele, die auf unterschiedliche Weise miteinander interagieren können: Ist ein Allel dominant gegenüber einem anderen, so unterdrückt es dessen Ausprägung vollkommen und das dominante Merkmal wird im Phänotyp sichtbar. Das unterdrückte Allel wird rezessiv genannt.
Bei einem kodominanten Erbgang können sich beide Allele unbeeinflusst voneinander ausprägen, während bei einem intermediären Erbgang eine Mischung aus beiden Merkmalen vorliegt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das AB0-Blutgruppensystem, bei dem A und B untereinander kodominant, aber 0 gegenüber dominant sind.
Was ist der normale Chromosomensatz beim Menschen?
Menschliche Zellen besitzen 22 geschlechtsunabhängige Chromosomenpaare (Autosomen) und zwei Geschlechtschromosomen (Gonosomen), also ergeben insgesamt 46 Chromosomen einen Chromosomensatz.
Autosomen liegen in der Regel in Paaren vor. Die Chromosomen eines Paares gleichen sich in Gestalt und Abfolge der Gene und werden daher als homolog bezeichnet. Auch die beiden X-Chromosomen der Frau sind homolog, wohingegen Männer ein X- und ein Y-Chromosom besitzen. Diese unterscheiden sich in der Form und der Anzahl der vorhandenen Gene derart, dass man nicht mehr von Homologie sprechen kann.
Keimzellen, also Ei- und Spermienzellen, besitzen durch die Meiose nur den halben Chromosomensatz nämlich jeweils 22 einzelne Autosomen und ein Gonosom. Da die Keimzellen bei der Befruchtung verschmelzen und manchmal auch ganze Segmente tauschen (Crossover), entsteht eine neue Kombination von Chromosomen (Rekombination). Alle Chromosomen zusammen werden als der Karyotyp bezeichnet, welcher mit wenigen Ausnahmen (siehe Chromosomenaberrationen) bei allen Individuen eines Geschlechts identisch ist.
Hier erfahren Sie alles zu Thema: Mitose - Einfach erklärt!
Warum gibt es immer Chromosomenpaare?
Im Grunde genommen lässt sich diese Frage mit einem Satz beantworten: Weil es sich als vorteilhaft erwiesen hat. Das Vorliegen der Chromosomenpaare und das Prinzip der Rekombination sind essentiell für Vererbung im Sinne der sexuellen Vermehrung. Auf diese Weise kann aus dem Genmaterial zweier Individuen per Zufallsprinzip ein wiederum vollkommen neuartiges Individuum entstehen.
Dieses System erhöht die Vielfalt an Eigenschaften innerhalb einer Art enorm und sorgt dafür, dass sie sich viel schneller und flexibler an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann, als dies nur mittels Mutation und Selektion möglich wäre.
Der doppelte Chromosomensatz hat auch eine schützende Wirkung: Wenn es durch Mutation eines Gens zu einem Ausfall der Funktion kommen würde, so gibt es in dem zweiten Chromosom immer noch eine Art „Sicherheitskopie“. Diese reicht dem Organismus zwar nicht immer aus, um die Fehlfunktion zu kompensieren, besonders wenn das mutierte Allel dominant ist, es erhöht jedoch die Chance darauf. Außerdem wird auf die Art die Mutation nicht automatisch an alle Nachkommen vererbt, was wiederum die Art vor allzu radikalen Mutationen schützt.
Was ist eine Chromosomenmutation?
Genetische Defekte können durch ionisierende Strahlung (z. B. Röntgen), chemische Substanzen (z. B. Benzopyren in Zigarettenrauch), bestimmte Viren (z. B. HP-Viren) oder mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch rein zufällig entstehen. Häufig sind mehrere Faktoren an der Entstehung beteiligt. Grundsätzlich können solche Veränderungen in allen Körpergeweben auftreten, aus praktischen Gründen beschränkt sich die Analyse aber in der Regel auf Lymphozyten (ein spezieller Typ Immunzellen), Fibroblasten (Bindegewebszellen) und Knochenmarkzellen.
Als Chromosomenmutation bezeichnet man große strukturelle Veränderung einzelner Chromosomen. Das Fehlen oder hinzukommen ganzer Chromosomen wäre dagegen eine Genom- oder Ploidiemutation, während der Begriff Genmutation sich auf vergleichsweise kleine Veränderungen innerhalb eines Gens bezieht. Die Bezeichnung Chromosomenaberration (lat. aberrare = abweichen) ist etwas weiter gefasst und umfasst alle mit dem Lichtmikroskop feststellbaren Veränderungen.
Mutationen können sich ganz unterschiedlich auswirken:
- Stille Mutation, also Mutationen bei denen die Veränderung keinerlei Auswirkungen auf das Individuum oder deren Nachkommen hat, sind bei Chromosomenaberrationen eher untypisch und finden sich häufiger im Bereich der Gen- bzw. Punktmutationen.
- Von einer Loss-of-Function Mutation spricht man, wenn durch die Mutation ein fehlgefaltetes und damit funktionsloses oder gar kein Protein entsteht.
- So genannte Gain-of-Function Mutationen verändern die Art der Wirkung oder die Menge an produzierten Proteinen derart, dass vollkommen neue Auswirkungen entstehen. Das ist einerseits ein entscheidender Mechanismus für die Evolution und damit für das Überleben einer Spezies bzw. das Entstehen neuer Arten, kann auf der anderen Seite aber auch, wie im Fall des Philadelphia-Chromosoms, entscheidend zur Entstehung von Krebszellen beitragen.
Am bekanntesten unter den unterschiedlichen Formen von Chromosomenaberrationen sind wohl die numerischen Aberrationen, bei der einzelne Chromosomen nur einfach (Monosomie) oder gleich dreifach (Trisomie) vorliegen.
Trifft dies nur auf ein einziges Chromosom zu, spricht man von Aneuploidie, ist der gesamte Chromosomensatz betroffen von Polyploidie (Tri- und Tetraploidie). In den meisten Fällen entsteht diese Fehlverteilung im Rahmen der Keimzellentwicklung durch Nicht-Trennung (Nondisjunction) der Chromosomen bei der Zellteilung (Meiose). So kommt es zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen und damit zur numerischen Aberration im entstehenden Kind.
Monosomien von nicht-geschlechtlichen Chromosomen (= Autosomen) sind nicht mit dem Leben vereinbar und kommen daher nicht bei lebenden Kindern vor. Auch die autosomalen Trisomien führen, abgesehen von Trisomie 13, 18 und 21, fast immer zu einer spontanen Fehlgeburt.
Auf jeden Fall kommt es im Gegensatz zu den Aberrationen der Geschlechtschromosomen, die auch eher unauffällig ausfallen können, immer zu schwerwiegenden klinischen Symptomen und in der Regel auch zu mehr oder weniger ausgeprägten äußerlichen Auffälligkeiten (Dysmorphien).
Eine solche Fehlverteilung kann aber auch später im Leben bei einer mitotischen Zellteilung (alle Zellen außer Keimzellen) auftreten. Da hier neben den betroffenen Zellen auch nicht veränderte Zellen vorliegen, spricht man von einem somatischen Mosaik. Mit somatisch (gr. soma = Körper) sind alle Zellen gemeint, die keine Keimzellen sind. Da hierbei nur ein kleiner Teil der Körperzellen betroffen ist, sind die Symptome in der Regel wesentlich milder. Mosaiktypen bleiben daher häufig lange Zeit unerkannt.
Hier erfahren Sie alles rund um das Thema: Chromosomenmutation
Was ist eine Chromosomenaberration?
Die strukturelle Chromosomenaberration entspricht im Grunde genommen der Definition der Chromosomenmutation (siehe oben). Bleibt dabei die Menge des genetischen Materials gleich und wird lediglich anders verteilt, spricht man von einer balancierten Aberration.
Dies geschieht häufig über Translokation, also die Übertragung eines Chromosomensegments auf ein anderes Chromosom. Handelt es sich dabei um einen Austausch zwischen zwei Chromosomen, spricht man von reziproker Translokation. Da nur etwa 2 % des Genoms zur Herstellung von Proteinen benötigt werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein solches Gen auf dem Bruchpunkt liegt und dadurch seine Funktion verliert oder in ihr beeinträchtigt wird. Daher bleibt eine solche balancierte Aberration häufig unbemerkt und wird über mehrere Generationen weitervererbt.
Allerdings kann es dadurch zu Fehlverteilungen der Chromosomen bei der Entstehung der Keimzellen kommen, wodurch Unfruchtbarkeit, spontane Fehlgeburten oder auch Nachkommen mit einer unbalancierten Aberration entstehen können.
Eine unbalancierte Aberration kann aber auch spontan, also ohne familiäre Vorgeschichte auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit unbalancierter Aberration lebend zur Welt kommt, hängt stark von den betroffenen Chromosomen ab und schwankt zwischen 0 und 60 %. Hierbei kommt es zum Verlust (= Deletion) oder zur Verdopplung (= Duplikation) eines Chromosomensegments. Man spricht in diesem Kontext auch von partiellen Mono- und Trisomien.
In manchen Fällen treten diese gemeinsam an zwei verschiedenen Regionen auf, wobei in der Regel die partielle Monosomie entscheidender für das Auftreten der klinischen Symptome ist. Prominente Beispiele für eine Deletion sind das Katzenschrei-Syndrom und das Wolf-Hirschhorn-Syndrom.
Von einer Mikrodeletion spricht man, wenn man die Veränderung nichtmehr mit dem Lichtmikroskop feststellen kann, also wenn es sich um den Verlust eines oder weniger Gene handelt. Dieses Phänomen gilt als ursächlich für das Prader-Willi-Syndrom und das Angelman-Syndrom und steht in starkem Zusammenhang zur Entstehung des Retionoblastoms.
Ein Sonderfall ist die Robertson-Translokation:
Dabei vereinigen sich zwei akrozentrische Chromosomen (13, 14, 15, 21, 22) an ihrem Zentromer und bilden nach Verlust der kurzen Arme ein einziges Chromosom(siehe Aufbau). Obwohl es hierbei zu einer reduzierten Chromosomenzahl kommt, spricht man hierbei von einer balancierten Aberration, da der Verlust der kurzen Arme bei diesen Chromosomen gut zu kompensieren ist. Auch hier sind die Auswirkungen häufig erst in den nachfolgenden Generationen auffällig, da es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Fehlgeburten oder lebenden Kindern mit einer Trisomie kommen kann.
Kommt es innerhalb eines Chromosoms zu zwei Brüchen, kann es passieren, dass das Zwischensegment um 180° gedreht in das Chromosom eingebaut wird. Dieser als Inversion bezeichnete Vorgang, ist nur dann nicht balanciert, wenn die Bruchstelle innerhalb eines aktiven Gens liegt (2 % des ges. Genmaterials). Je nachdem, ob das Zentromer inner- oder außerhalb des invertierten Segments liegt, handelt es sich um eine peri- oder parazentrische Inversion. Auch diese Veränderungen können zur ungleichmäßigen Verteilung des Genmaterials auf die Keimzellen beitragen.
Bei der parazentrischen Inversion, bei der das Zentromer nicht im invertierten Segment liegt, können auch Keimzellen mit zwei oder gar keinem Zentromer kommen. Dadurch geht das entsprechende Chromosom schon bei den allerersten Zellteilungen verloren, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Fehlgeburt führt.
Als Insertion bezeichnet man den Einbau eines Chromosomenfragments an anderer Stelle. Auch hier sind in ähnlicher Weise primär die Nachkommen betroffen. Zu einem Ringchromosom kann es insbesondere nach einer Deletion der Endstücke kommen. Dabei sind die Art und die Größe der Sequenzen für die Schwere der Symptome entscheidend. Außerdem kann es hier zu Fehlverteilungen und damit wiederum zu Mosaiktypen innerhalb der Körperzellen kommen.
Trennt sich das Metaphase-Chromosom bei der Zellteilung falsch, kann es zu Isochromosomen kommen. Dies sind zwei exakt gleiche Chromosomen, die nur aus langen oder nur aus kurzen Armen bestehen. Dies kann sich im Falle des X-Chromosoms wie ein Ulrich-Turner-Syndrom (Monosomie X) äußern.
Lesen Sie weitere Informationen zu diesem Thema: Chromosomenaberration
Trisomie 21
Trisomie 21, besser bekannt als Down-Syndrom, ist die wohl häufigste numerische Chromosomenaberration unter den Lebendgeburten, wobei das männliche Geschlecht geringfügig häufiger betroffen ist (1,3:1).
Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Trisomie 21 hängt von unterschiedlichen demografischen Faktoren, wie zum Beispiel dem durchschnittlichen Gebäralter der Mütter ab und ist von Region zu Region leicht unterschiedlich.
Die Trisomie 21 entsteht zu 95 % als Folge eines Teilungsfehlers im Rahmen der Meiose (Keimzellteilung), nämlich der Nondisjunction, also der ausbleibenden Trennung der Schwesterchromatiden.
Diese werden als freie Trisomien bezeichnet und entstehen zu 90 % im mütterlichen, zu 5 % im väterlichen und zu weiteren 5 % im embryonalen Genom.
Weitere 3 % entstehen durch unbalancierte Translokationen entweder an Chromosom 14 oder als 21; 21-Translokation, wodurch ein normales und ein doppeltes Chromosom 21 entsteht. Die restlichen 2 % sind Mosaiktypen, bei denen die Trisomie nicht in Keimzellen entstanden ist und daher nicht alle Körperzellen betrifft. Mosaiktypen fallen häufig so mild aus, dass sie lange Zeit vollkommen unerkannt bleiben können.
In jedem Fall sollte eine Chromosomenuntersuchung erfolgen, um die symptomatisch identische freie Trisomie von der unter Umständen vererbten Translokations-Trisomie zu unterscheiden. Eine Familienanamnese der vorhergehenden Generationen kann danach erfolgen.
Haben Sie weiteres Interesse zu diesem Thema? Lesen Sie nächsten Artikel hierzu: Trisomie 21
Trisomie 13
Trisomie 13 oder Pätau-Syndrom hat eine Häufigkeit von 1:5000 und ist wesentlich seltener als das Down-Syndrom. Die Ursachen (freie Trisomien, Translokationen und Mosaiktypen) und deren prozentuale Verteilung sind allerdings weitestgehend identisch.
Theoretisch könnten fast alle Fälle pränatal mittels Ultraschall oder PAPP-A-Test diagnostiziert werden. Da der PAPP-A-Test aber nicht unbedingt zu den Routineuntersuchungen zählt, werden in Mitteleuropa etwa 80 % der Fälle schon vor der Geburt diagnostiziert.
Schon im Ultraschall lassen sich ein Wachstumsrückstand, eine beidseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und ungewöhnlich kleine Augen (Mikrophthalmie) erkennen. Außerdem liegen meist unterschiedlich schwere Fehlbildungen des Vorderhirns und des Gesichts vor (Holoprosenzephalie).
Während bei der lobären Form die Trennung der Hirnhemisphären fast vollständig erfolgt und Seitenventrikel angelegt wurden, ist bei der semilobären Form häufig nur der hintere Teil des Hirns getrennt und die Seitenventrikel fehlen. Bei der schwersten, der alobären Form, findet gar keine Trennung der Hirnhemisphären statt.
Säuglinge mit semi- oder alobärer Form versterben meistens schon unmittelbar nach der Geburt. Nach einem Monat liegt die Sterblichkeitsrate bei ca. 50 % der Lebendgeburten. Bis zum 5. Lebensjahr steigt die Sterblichkeitsrate bei Trisomie 13 auf 90 % an. Durch die Fehlbildungen im Gehirn liegt in den meisten Fällen bleiben Erkrankte ihr Leben lang bettlägerig und können nicht sprechen, weswegen sie auf vollumfängliche Pflege angewiesen sind. Zudem kann es auch zu weitreichenden körperlichen Ausprägungen der Trismoie 13 kommen.
Lesen Sie mehr zum Thema unter: Trisomie 13 beim Ungeborenen
Trisomie 16
Im Grunde genommen ist die Trisomie 16 die häufigste Trisomie (etwa 32 % aller Trisomien), allerdings sind lebende Kinder mit einer Trisomie 16 eine große Seltenheit. Überhaupt kommen Lebendgeburten nur bei partiellen Trisomien oder Mosaiktypen vor. Dafür ist sie unter den Trisomien am häufigsten für Totgeburten verantwortlich: 32 von 100 Fehlgeburten aufgrund von Chromosomenaberrationen geht auf diese Trisomieform zurück.
Daher sind auch hauptsächlich pränatal, also vorgeburtlich, feststellbare Merkmale dokumentiert worden. Nennenswert sind hier diverse Herzfehler, ein verlangsamtes Wachstum, eine einzelne Nabelschnurrarterie (sonst doppelt) und eine erhöhte Nackentransparenz, welche sich durch Flüssigkeitsansammlungen aufgrund des noch nicht vollständig entwickelten Lymphsystems und der erhöhten Dehnbarkeit der Haut in diesem Bereich erklärt. Außerdem bildet sich häufig der physiologische Nabelbruch, also das zwischenzeitliche Verlagern eines großen Teils des Darms durch den Nabel nach außen, nicht richtig zurück, was man als Omphalozele oder Nabelschnurrbruch bezeichnet.
Auch eine Flexionskontraktur mit überkreuzten Fingern lässt sich häufig im Ultraschall feststellen. Bei den wenigen Lebendgeburten ist eine generalisierte Muskelhypotonie, also eine allgemeine Muskelschwäche, auffällig. Diese führt zu einer Trinkschwäche und kann dafür sorgen, dass der Säugling künstlich ernährt werden muss. Häufig tritt auch die für Trisomien so charakteristische Vierfingerfurche auf. Auch hier steht die Häufigkeit des Auftretens der Trisomie in direktem Zusammenhang zum Alter der Mutter.
Trisomie 18
Das Edwards-Syndrom, also Trisomie 18, tritt mit einer Häufigkeit von 1:3000 auf. Mit der pränatalen Diagnostik verhält es sich wie beim Pätau-Syndrom: Auch hier wäre mit denselben Untersuchungen ein vollständiges Auffinden aller Erkrankten noch vor der Geburt möglich. Die Ursachen und ihre Verteilungen sind mit anderen Trisomien zu vergleichen (siehe Trisomie 21).
Außerdem kommen bei der Trisomie 18 auch partielle Trisomien vor, welche wie die Mosaiktypen zu wesentlich milderen klinischen Verläufen führen. Die zugehörigen Dysmorphien sind auch beim Edwards-Syndrom äußerst charakteristisch: Erkrankte haben schon bei der Geburt mit 2 kg ein stark verringertes Körpergewicht (normal: 2,8-4,2kg), eine fliehende breite Stirn, eine generell unterentwickelte untere Gesichtshälfte mit kleiner Mundöffnung, engen Lidspalten und nach hinten rotierten, formveränderten Ohren (Faunenohr). Daneben fällt der für ein Neugeborenes ungewöhnlich stark entwickelte Hinterkopf auf. Die Rippen sind ungewöhnlich schmal und zerbrechlich. Neugeborene besitzen zudem eine Daueranspannung (Tonus) der gesamten Muskulatur, der sich aber bei den Überlebenden nach den ersten Wochen zurückbildet.
Weiterhin charakteristisch sind das Überkreuzen des 2. und 5. Fingers über den 3. und den 4. bei insgesamt eingeschlagenen Fingern, während die Füße ungewöhnlich lang (verstrichen) sind, eine besonders ausgeprägte Ferse, verkümmerte Zehennägel und eine zurückversetzte große Zehe besitzen.
Schwere Organfehlbildungen sind häufig und treten meistens in Kombination auf: Herz- und Nierenfehler, Fehlfaltung (Malrotation) des Darms, Verwachsungen des Bauchfells (Mesenterium commune), ein Verschluss der Speiseröhre (Ösophagusatresie)und viele weitere.
Auf Grund dieser Fehlbildungen ist die Sterblichkeitsrate bei ca. 50 % innerhalb der ersten 4 Tage, nur etwa 5-10 % werden über ein Jahr alt. Ein Überleben bis ins Erwachsenenalter stellt die absolute Ausnahme dar. In jedem Fall ist eine Intelligenzminderung sehr ausgeprägt und können nicht sprechen, sind bettlägerig und inkontinent, also vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen.
Für detailliertere Informationen zum Thema Trisomie 18 lesen Sie auch unseren ausführlichen Artikel zum Thema:
- Trisomie 18 (Edwards-Syndrom)
- Trisomie 18 beim Ungeborenen
Trisomie X
Die Trisomie X ist die unauffälligste Form der numerischen Chromosomenaberration, das Aussehen der Betroffenen, die logischerweise alle weiblich sind, weicht nicht großartig von anderen Frauen ab. Einige fallen dadurch auf, dass sie besonders groß sind und etwas „plumpere“ Gesichtszüge haben. Auch die geistige Entwicklung kann weitestgehend normal verlaufen, die Spannweite reicht hier von grenzwertig normal bis zu milder geistiger Behinderung.
Allerdings fällt dieses Intelligenzdefizit doch etwas gewichtiger aus, als bei den anderen Trisomien der Geschlechtschromosomen (XXY und XYY). Mit einer Häufigkeit von 1:1000 ist sie im Grunde gar nicht so selten, da die Trisomie in der Regel aber nicht mit klinisch bedeutsamen Symptomen einhergeht, wird ein Großteil der erkrankten Frauen vermutlich ihr Leben lang nie diagnostiziert.
Trägerinnen werden meistens zufällig im Rahmen einer Familienabklärung oder bei vorgeburtlicher Diagnostik entdeckt. Die Fertilität kann leicht herabgesetzt sein und die Rate von Geschlechtschromosomenaberrationen in der Nachfolgegeneration ist unter Umständen geringfügig erhöht, sodass sich bei Kinderwunsch eine genetische Beratung empfiehlt.
Wie bei den anderen Trisomien entsteht auch die Trisomie X am häufigsten als freie Trisomie, also durch eine ausbleibende Teilung (Nondisjunction) der Schwesterchromatiden. Auch hier entsteht sie meist bei der Reifung der mütterlichen Eizellen, wobei die Wahrscheinlichkeit mit dem Alter ansteigt.
Fragiles-X-Syndrom
Das Fragile-X-Syndrom oder Martin-Bell-Syndrom äußert sich bevorzugt bei Männern, da diese nur ein X-Chromosom haben und daher stärker durch die Veränderung betroffen sind.
Unter den männlichen Lebendgeburten eines Jahres tritt es mit einer Häufigkeit von 1:1250 auf und ist damit die häufigste Form der unspezifischen geistigen Retardierung, also aller geistigen Behinderungen, die sich nicht durch ein spezielles Syndrom mit typischen Zeichen beschreiben lassen.
Das Fragile-X-Syndrom kann in meistens etwas schwächerer Form auch bei Mädchen auftreten, was an der zufälligen Inaktivierung jeweils eines der X-Chromosome liegt. Je höher der Anteil des abgeschalteten gesunden X-Chromosoms ist, desto stärker auch die Symptomatik.
Meistens sind Frauen jedoch Träger der Prämutation, welche noch keine klinischen Symptome hervorruft, aber die Wahrscheinlichkeit der vollen Mutation bei ihren Söhnen massiv erhöht. In ganz seltenen Fällen können auch Männer die Träger der Prämutation sein, welche sie dann ausschließlich an Töchter vererben können, die aber in der Regel auch klinisch gesund sind (Sherman-Paradox).
Ausgelöst wird das Syndrom durch eine extrem erhöhte Anzahl an CGG-Tripletts (eine bestimmte Basenfolge) im FMR-Gen (Fragile-site-mental-retardation), statt der 10-50 Kopien finden sich in der Prämutation 50-200, bei voller Ausprägung 200-2000 Kopien.
Unter dem Lichtmikroskop mutet dies wie ein Bruch im langen Arm an, was dem Syndrom seinen Namen gab. Dies führt zur Abschaltung des betroffenen Gens, was wiederum die Symptomatik hervorruft.
Betroffene zeigen eine verlangsamte Sprach- und Bewegungsentwicklung und können Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die in Richtung Hyperaktivität, aber auch Autismus gehen können. Rein äußerliche Auffälligkeiten (Dysmorphiezeichen) sind ein langes Gesicht mit prominentem Kinn und abstehende Ohren. Mit der Pubertät treten häufig stark vergrößerte Hoden (Makroorchidie) und eine Vergröberung der Gesichtszüge auf. Unter weiblichen Trägern der Prämutation gibt es eine leichte Häufung psychischer Auffälligkeiten und einer besonders frühen Menopause.
Was ist eine Chromosomenanalyse?
Unter einer Chromosomenanalyse versteht man ein Verfahren in der Zytogenetik mit dem numerische oder strukturelle Chromosomenaberrationen nachgewiesen werden können.
Eine solche Analyse würde man zum Beispiel bei einem unmittelbaren Verdacht auf ein chromosomales Syndrom, also bei Fehlbildungen (Dysmorphien) oder geistiger Behinderung (Retardierung), aber auch bei Infertilität, regelmäßigen Fehlgeburten (Aborten) und auch bei bestimmten Krebserkrankungen (z. B. Lymphome oder Leukämien) einsetzen.
Dazu benötigt man normalerweise Lymphozyten, ein spezieller Typ Immunzellen, die man aus dem Blut des Patienten gewinnt. Da man auf diese Art aber nur eine vergleichsweise geringe Menge gewinnen kann, regt man die Zellen mit Phytohämagglutinin zur Teilung an und kann damit die Lymphozyten im Labor anzüchten.
In einigen Fällen nimmt man stattdessen Proben (Biopsien) aus Haut oder Rückenmark, mit denen man ganz ähnlich verfährt. Ziel ist es möglichst viel DNA-Material zu gewinnen, welches sich gerade mitten in der Zellteilung, befindet. In der Metaphase ordnen sich alle Chromosomen etwa in der Mitte der Zelle in einer Ebene an, um im nächsten Schritt, der Anaphase, zu den gegenüberliegenden Seiten (Polen) der Zelle gezogen zu werden.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Chromosomen besonders dicht gepackt (hochkondensiert). Dazu gibt man das Spindelgift Kolchizin hinzu, welches genau in dieser Phase des Zellzyklus wirkt, sodass sich die Metaphase-Chromosomen anreichern. Daraufhin werden sie isoliert und mittels spezieller Färbemethoden, angefärbt.
Am meisten verbreitet ist die GTG-Bänderung, bei der die Chromosomen mit Trypsin, einem Verdauungsenzym, und dem Farbstoff Giemsa behandelt werden. Dabei werden die besonders dicht gepackten und die adenin- und thyminreichen Regionen dunkel dargestellt.
Die dadurch entstehenden G-Bänder sind für jedes Chromosom charakteristisch und gelten vereinfacht betrachtet als die eher genarmen Regionen. Von den derartig angefärbten Chromosomen wird bei tausendfacher Vergrößerung ein Bild aufgenommen und mit Hilfe eines Computerprogramms ein Karyogramm erstellt. Hierzu werden neben dem Bandenmuster auch die Größe des Chromosoms und die Lage des Zentromers zu Hilfe genommen, um die Chromosomen entsprechend zu ordnen. Daneben gibt es aber auch andere Bänderungsmethoden, die ganz unterschiedliche Vorteile haben können.
Empfehlungen aus der Redaktion
Weitere allgemeine Informationen erfahren Sie in folgenden Artikeln: